Man kann sich fragen ob die international Koproduktion „Die Maisinsel“ ein georgischer Film ist? Der Filmmacher stammt daher und thematisch ist die Geschichte auch dort angesiedelt. Das Drama beschwört auf poetische Weise die Macht der Bilder, kommt ohne viele Worte aus und thematisiert dabei auch aktuelle Grenzkonflikte. „Die Maisinsel“ konnte vor dem Kinostart 2015 international auf diversen Festivals überzeugen und würde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Mit dem Film-Ende hatte ich so meine Schwierigkeiten, aber das muss jeder selbst sehen.
In „Die Maisinsel“ werden vielleicht zehn Sätze gesprochen; auf Abchasisch, Georgisch und Russisch. Das einfache Leben der Bauern kommt ohne Worte aus. Selbst die Anleitung der Enkelin erfolgt durch Beispiel und Nachahmung und entwickelt so ihre eigene Dynamik.
Der Fluss Enguri fließt vom Kaukasus-Gebirge nach Süden ins Schwarze Meer und markiert dabei seit dem Waffenstillstand 1994 die Grenzlinie zwischen Georgien und Abachsien. Jedes Frühjahr zur Schneeschmelze führt der Enguri so viel Schutt und fruchtbaren Boden mit sich, dass sich regelmäßig keine Inseln ausbilde sobald der Fluss die Ebene erreicht und langsamer fließt. Wenn im Herbst die Regenzeit einsetzt, werden die Flussinseln wieder weggeschwemmt. Die armen Bauern der Region nutzen die Flussinseln traditionell, um dort Mais anzubauen, der die Familien durch den Winter bringen soll.
Der alte Bauer Abga (Ilyas Salman) stakt mit seinem Boot zu einer dieser Inseln und markiert sie mit einem weißen Tuch. Dann errichtet er aus schlichten Baumaterialien vom Ufern eine einfache Hütte auf der Insel. Nachdem der Boden vorbereitet ist, bekommt der Alte Hilfe von seiner jungen Enkelin Asida (Mariam Buturishvili). Er bringt ihr bei wie man fischt und wie man den Mais bearbeitet.
Das temporäre Land im Fluss gehört nur dem, der es sich aneignet, weil die Inseln genau auf der Grenzlinie zwischen Abchasien und Georgien liegen. Über Monate leben und arbeiten der Bauer und seine Enkelin auf ihrer Insel. Immer wieder fahren Grenzpatrouillen vorbei, gelegentlich verirrt sich ein Reh auf die Insel. Eines Morgens findet Asida einen schwer verwundeten Soldaten im Mais. Trotz der Gefahr pflegen der Bauer und die Enkelin den Soldaten wieder halbwegs gesund.
In George Ovashvilis zweitem Spielfilm würden gesprochene Worte nur stören. Fast ist es so, als sei Sprache an sich ein Akt des Eindringens in die majestätische Flusslandschaft zu Füßen des Kaukasus und die naturgegebene Rhythmik. Doch Worte wiegen schwer, wenn gesprochen wird. Knapp wird im Dialog von Bauer und Enkelin umrissen, dass sie Waise ist, nächstes Jahr die Schule beendet und und der Großvater nicht glaubt, dann noch am Leben zu sein. Die anderen gesprochenen Einsprengsel verdeutlichen nur allzu gut die Gefährdung dieser zerbrechlichen Nische auf dem Fluss – immer geht es um das Eindringen der Soldaten in diese friedliche Welt.
Bereits mit seinem Spielfilmdebut „Das andere Ufer“ (lief 2009 auf der Berlinale, bekam diverse international Preise) beschäftigte sich der georgische Filmmacher mit dem Verhältnis zwischen Georgien und der sich abspaltenden Region Abchasien. Doch in „Die Maisinsel“ geht es weniger um aktuelle politische Konflikte als um ein poetisches Abbild des Lebenszyklus. Der Fluss ist dafür ein eingängiges Symbol. Während der alte Bauer seinen Frieden mit seiner Existenz gemacht hat, ist es vor allem das junge Mädchen, das in dieser Situation langsam und auch behutsam erwachsen wird und zugleich eine Sehnsucht nach Freiheit spürt.
Dafür findet „Die Maisinsel“ wunderbare, in ihrer Natürlichkeit fast entrückt wirkende Bilder. Meisterhaft erschafft der ungarische Kameramann Elemér Ragályi eine Bildwelt, die fast schon zu idyllisch ist. Dabei ist die kluge und sensible Beobachtung der Charaktere nie ein Kontrast zu der überbordenden Landschaft, sondern zeigt den Menschen als Teil jenes natürlichen Gefüges. Die Soldaten, die ordnende und doch willkürliche Macht der Zivilisation bleibt die Ausnahme. Vor allem die Bilder erzeugen eine starke poetische Wirkung. Die Handlung ist bewusst schlicht und parabelhaft gehalten und erinnert in ihrer kargen Figurenaufstellung auch fast an ein Märchen.
Und so muss man wohl auch das Ende des Films eher als symbolisch und an den Naturrhythmus angepasst betrachten, denn als rational verständlich. Denn hier offenbart „Die Maisinsel“ eine Wendung, die sich mir nicht erschlossen hat und die mich mit George Ovashvilis hochgelobtem Film hadern ließ.
Ein weiterer Aspekt, den wohl jeder Zuschauer sehr subjektiv empfinden wird, ist die Präsenz der Soldaten im Film. Sie stellen einen Störfaktor, eine latente Bedrohung dar, die sich immer wieder Gehör verschafft, aber bedrohliche Spannung wird dabei dramaturgisch nicht aufgebaut oder dabei verpufft schnell, weil früh klar wird, dass die beiden Seiten des Grenzkonflikts den alten Mann auf seiner Insel gewähren lassen – soweit er sich auf die Landwirtschaft und Fischerei beschränkt.
Das international koproduzierte georgische Drama „Die Maisinsel“ besticht vor allem mit der Naturverbundenheit seiner Geschichte und seine kraftvolle und klare Bildsprache. Die schlichte Geschichte eines alten Bauern und seiner Enkelin versteht sich selbst als Modell des Lebens und ist auch ein wenig politisch. Wirkmächtig ist das stille Drama allerdings weniger als Parabel denn als Poesie.
Film-Wertung: 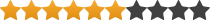 (6 / 10)
(6 / 10)
Die Maisinsel
OT: Simindis kundzuli
Länge: 100 Minuten, GO/D/F/CZ/KZ, 2014
Genre: Drama
Regie: George Ovashvilis
Darsteller: Ilyas Salman, Mariam Buturishvili
FSK: ohne Altersbeschränkung
Vertrieb: Neue Visionen, Indigo
Kinostart. 28.05.2015
DVD -VÖ: 04.12.2015





